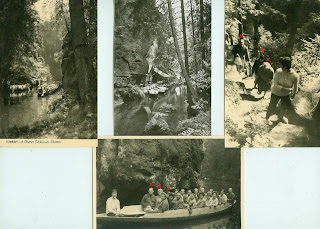„Gruß aus...“- Ansichtskarten, die um 1900 millionenfach hergestellt wurden, die gab es auch noch in der DDR, wie die Beispiele auf meinem 1. Scan zeigen. Als Dessauer habe ich mal Ansichtskarten der 60er und 70er Jahre aus Dessau eingescannt. Damals von meiner Mutter gekauft um sie zu verschicken, überstanden sie die Zeiten und mittlerweile haben sie auch schon nostalgischen Charakter und rufen Erinnerungen hervor. Etliches hat sich mittlerweile im Stadtbild Dessaus verändert, aber nicht unbedingt zum Besseren oder Ästhetischeren.
Auf dem 2. Scan, auf der ersten Postkarte, ist die Museumskreuzung zu sehen, das frühere Stadtzentrum, welches sich jetzt mehr in Richtung Rathauscenter verschoben hat. Das blaufarbene Gebäude rechts oben auf der Postkarte ist das frühere Kaufhaus „Magnet“, welches leider nach der Wende leer steht: tot!. Wunderbar fand ich damals das Restaurant auf der Dachterrasse, ein Highlight welches jetzt Dessau nicht zu bieten hat. Links unten sieht man eine Ecke des „Restaurants am Museum“ mit der „Afrikana-Bar“, ein sehr schönes Restaurant. Jetzt ist eine Bank darin und die früher so interessante Ecke ist: tot! Auf der zweiten Postkarte sieht man die Museumskreuzung aus einem anderen Blickwinkel, das Museum und die Georgenkirche im Hintergrund, rechts daneben das „konsument“-Kaufhaus, auch ein schönes Kaufhaus damals. Zum Glück wurde nach dem Abriß wieder ein ebenbürtiges Objekt dort hin gebaut, das „Dessau-Center“. Jahrelang war die Gegend nach der Wende: tot! Die dritte Postkarte zeigt im Hintergrund die Ypsilon-Häuser und die große Kaufhalle davor. Die Kaufhalle steht noch, wird aber leider nicht mehr als Kaufhalle genutzt: tot! Auf der letzten Karte des 2. Scans, der bekannte Dessauer Hauptbahnhof wie er immer noch so vorhanden ist. Der Autobus auf dem Foto ist ein ungarischer „Ikarus“. Diese Busse fuhren in ganz Dessau und hatten in den 60er Jahren die interessanten Doppelstockbusse abgelöst.
Der 3. Scan zeigt Karten des Springbrunnens im Dessauer Stadtpark in zwei Ausführungen. Die Stadtplaner meinten schon damals den Stadtpark verändern zu müssen. Da wurden schon damals die Gelder sinnlos raus geschmissen, denn der auf der ersten Postkarte abgebildete Springbrunnen der 70er Jahre war nicht besser als der auf der zweiten Karte gezeigte der 60er Jahre. Und was die Schildbürger und Raubritter auf dem Rathaus nach der Wende mit den dauernden Veränderungen am Springbrunnen veranstalteten, das geht auf keine Kuhhaut. Andauernd wird die Wegeführung verändert, unter dem Motto „Dessau hat´s ja, auf´s Geld kommt´s nicht an, die Bürger kann man ja mit höheren Steuern und Abgaben schön schröpfen!“ 3. Karte: zwei der drei Hochhäuser an der Mulduferrandstraße und 4. Karte: Häuser in der Antoinettenstraße, mit Läden, wo zum Glück auch heute noch Läden drin sind.
Wenig verändert hat sich städtebaulich was auf den Postkarten des 4. Scans abgebildet ist, wie der Zerbster Straße (1. Karte), wo man allerdings noch die Straßenbahnschienen sieht, schließlich konnte man in den 60er Jahren noch bis zum Rosenhof mit der Straßenbahn fahren. So leer wie auf den meisten obigen Postkarten waren die Straßen allerdings in den 60er und 70er Jahren nicht, da hatten die Fotografen wohl Momente ausgesucht, wo kaum Betrieb auf den Straßen war. Typisch für die 60er Jahre, die Lederhosen des Jungen der mit seiner Mutter die Johannisstraße vor der Johanniskirche entlang läuft (2. Ansichtskarte). Ja und dann (3. Ansichtskarte) das legendäre „Café Tirana“. Eine Lokalität besteht zwar immer noch in diesen Räumen, aber so exklusiv wie zu Zeiten des „Café Tirana“ war kein späteres Restaurant. Gern erinnere ich mich an den herrlichen Garten wo man wunderbar sitzen konnte, dazu die tolle Mosaiksäule von Carl Marx und die großen Wandbilder, welche die albanische Geschichte zeigten. Was wohl aus ihnen geworden ist? Bestimmt waren da, wie so oft in der Geschichte Deutschlands die Bilderstürmer am Werk. 4. Karte: die Hauptpost = keine Veränderung zu heute!
Keine Veränderungen auch beim Theater und dem Friedensplatz (1. und 2. Karte des 5. Scans), allerdings gibt es den auf der 3. Karte noch vorhandenen Busbahnhof nicht mehr, da steht jetzt das Leopold–Carré mitsamt Hotel. Um den Busbahnhof ist es nicht schade, das Leopold-Carré ist eine Bereicherung für die Stadt und paßt da gut hin. Jammerschade ist es allerdings um die Bauhaus-Kaufhalle, auf der 4. Karte des 5. Scans, unten eine moderne Kaufhalle und oben eine tolle Tanzbar, das „Bauhaus-Café“, wo ich sehr oft in den 70er Jahren Gast war. Noch ein paar Jahre nach der Wende wurde die Kaufhalle als Supermarkt der „Pfannkuch“-Handelskette genutzt, danach: tot! Wie man ein solches Objekt sterben lassen kann, dies ist mir ein Rätsel, die Tanzbar war doch wirklich toll, schon von der Eleganz her.
Auf dem 6. Scan sind 3 Postkarten des Waldbads Dessau zu sehen, ein wirklich modernes elegantes Freibad (mit FKK-Bereich) und stadtnah im Süden Dessaus gelegen. Ich war sehr oft früher dort und da nicht nur im Bad selber, sondern auch in dem tollen Restaurant, welches absolut kein einfaches Badrestaurant war, sondern sehr vornehm. Man fühlte sich dort wie in Italien, schon wegen des großzügigen Blicks und der Terrassen. Nach der Wende: das Restaurant ist tot und das Bad dümpelt vor sich hin, der alte Glanz ist dahin. Die 4. Postkarte zeigt das Strandbad „Große Adria“ bei Dessau. In der Hitlerzeit entstanden, überlebten die Gebäude und Anlagen die Zeitenläufte bis jetzt.
Auf dem letzten Scan sieht man auf der ersten Karte die damalige Thälmannallee (jetzige Gropiusallee) am Kreisverkehr an den „Sieben Säulen“. Das Gebäude auf der Karte beherbergte die beliebte private Buchhandlung „An den Sieben Säulen“, Inhaber waren die Neuberts, die durch ihre Buchhandlung stadtbekannt waren. Da an diesem Kreisverkehr der Stadtteil Ziebigk begann, wo ich als Kind und auch später jahrzehntelang beheimatet war, da zog es mich zu gern immer wieder zu dieser Buchhandlung hin, die auch Papierwaren aller Art führte. Dort kaufte ich mir meine ersten Bücher und auch wenn ich gar nichts kaufen wollte, zog es mich dort hin, allein um mir die Buchauslagen im Schaufenster anzusehen. Ja und jetzt, was ist geblieben? Radikal alles weg, die traditionsreiche Ecke ist tot! Und was städtebaulich mit der Umgebung der „Sieben Säulen“ geschah, spottet ebenfalls jeder Beschreibung, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln! Einmal schafft man den Kreisverkehr ab, dann baut man wieder einen neuen, man kann nur mit dem Kopf schütteln über die Stadtplaner die so mit unserem Geld umgehen. Das Mausoleum der Dessauer Fürstenfamilie steht wie eh und je dort (siehe: 2. Postkarte), dieser Bau gibt der Stadt Dessau ein unverwechselbares Bild. Toll wie die Kuppel im Sonnenschein glänzt und man dies schon von weiten sehen kann. Die 3. Postkarte zeigt die „Sieben Säulen“, ein Bauwerk welches zum Georgengarten gehört, auch da gibt es keine Veränderungen zu damals. Ebenso gleich geblieben ist die auf der letzten Postkarte abgebildete römisch-katholische Kirche in Dessau-Süd. Auf der Rückseite der ca. 40 Jahre alten Postkarte steht: Dessau-Süd, Kath. Kirche „Allerheiligste Dreieinigkeit“. Schon damals machte die Kirche nebst Umgebung einen gepflegten Eindruck und dies in einem weitestgehend atheistischen Staat.